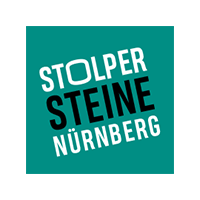Das Mädchenlyzeum mit Realgymnasium Findelgasse-Frauentorgraben von Wolf-Martin Hergert
Die seit 1823 bestehende ehemalige „Höhere Töchterschule“ widmete sich von Beginn an der Bildung von Mädchen in Nürnberg. Stets in kommunaler Hand erfüllte sie eine wichtige Aufgabe bei der Ausbildung des weiblichen Nachwuchses nicht nur aus wohlhabenden Haushalten, sondern, durch das Angebot von „Freiplätzen“, auch für die weniger betuchten Familien. Anders als die beiden deutlich später gegründeten kirchlichen Mädchenschulen war sie dabei stets überkonfessionell ausgerichtet. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts besuchten zunehmend auch Mädchen jüdischen Glaubens die Schule.
1886 bezog die Schule nach etlichen Provisorien das im vormaligen Garten des städtischen „Findelhauses“ erbauten Schulhaus Findelgasse 9. Nachdem die stetig wachsende Schule mit dem vormals privat geführten „Port’schen Institut“ vereinigt worden war kam als zweiter Standort ein Schulhaus am Frauentorgraben beim Färbertor hinzu.
Aus der „Höheren Töchterschule“ entwickelte sich in den Folgejahren eine klassische höhere Mädchenschule, die sich auf moderne Fremdsprachen und Naturwissenschaften konzentrierte und sich allmählich den Stundenplänen der „realistischen“ Jungenschulen annäherte. Treibende Kräfte waren der städtische Schulinspektor Friedrich Glauning und der erste nicht-kirchliche Schulleiter August Ullrich. Auch die erste promovierte Frau Bayerns, die Lehrerin Bertha Kipfmüller unterrichtete an der Schule, welche 1902 ihren Schülerinnen erstmals den Weg zur Hochschulreife ermöglichte und ab 1904 einen regulären Realgymnasialzweig anbieten konnte.
Nach dem Ersten Weltkrieg konnte in der Ära des Oberbürgermeisters Hermann Luppe und unter der Leitung des Städtischen Schulreferenten Konrad Weiß und des Schulleiters Benedikt Uhlemayr die städtischen Höheren Mädchenschulen (zu denen auch die Labenwolfschule gehörte) in demokratischer Zielrichtung zügig ausgebaut werden. Es entstanden moderne Lehrsäle für Chemie und Physik, damals hochmoderne moderne Medien wie Schulfilme und Schulfunk wurden eingeführt und sowohl die Schülerinnen als auch die Eltern erhielten Mitsprache in schulorganisatorischen Fragen durch die Einrichtung von Allgemeinen Schüler- und Elternausschüssen.
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten beendete diese hoffnungsvolle Entwicklung abrupt. Der demokratische Schulleiter Uhlemayr wurde in einem irregulären Verfahren öffentlich vor seinen Schülerinnen gedemütigt und abgesetzt und durch den überzeugten und nahezu pathologisch antisemitisch eingestellten Lehrer Anton Laemmermeyr ersetzt. Laemmermeyr begann bereits Ende März 1933 mit der gezielten Denunziation „demokratisch“ oder „pazifistisch“ eingestellter Lehrkräfte und schikanierte die damals noch zahlreich vorhandenen jüdischen Mädchen in einer Weise, die selbst die antisemitischen Anweisungen und Vorgaben der Machthaber deutlich überstieg. Rassismus und Antisemitismus wurde nun zum Erziehungsziel, Rückendeckung erhielt Laemmermeyr von dem nationalsozialistischen Schulreferenten Fritz Fink, der als eifriger Schreiber für Julius Streichers Hetzblatt „Der Stürmer“ agierte und 1937 mit seiner Schrift „Die Judenfrage im Unterricht“ eine stark rezipierte Handreichung zum praktizierten Antisemitismus für Lehrkräfte herausgab.
Bis 1935/36 hatte Laemmermeyr sämtliche 120 jüdischen Mädchen, die die Schule 1933/34 noch besucht hatten, vertrieben. Nur eine Handvoll von ihnen wurden vom vergleichsweise gemäßigt eingestellten Schulleiter Fritz Hilsenbeck an der Labenwolfschule noch für einige Monate aufgenommen. Die allermeisten konnten ihre höhere Schulbildung nicht abschließen, und wenn es ihnen doch gelang, standen ihnen weder Hochschulen, noch gut qualifizierte Arbeitsplätze offen. Manche versuchten einen Volks- oder Berufsschulabschluss an den wenigen jüdischen Konfessionsschulen innerhalb und außerhalb Bayerns zu erreichen und sich auf die Auswanderung aus Deutschland vorbereiten. Andere Mädchen gingen „in Stellung“ oder nahmen eine Lehre auf, unter anderem in jüdischen Kranken- oder Pflegeeinrichtungen.
Nach dem Novemberpogrom 1938 gab es für Menschen jüdischer Herkunft kaum noch Möglichkeiten für eine berufliche oder schulische Weiterbildung in Deutschland. Wer konnte, versuchte Deutschland zu verlassen. Buchstäblich in letzter Minute retteten einige Kindertransporte 1938 und 1939 einigen Mädchen das Leben, während ihre in Deutschland verbliebenen Angehörigen meist ermordet wurden. Wer nach Frankreich, der Tschechoslowakei oder den Niederlanden floh, gelangte mit Beginn des Zweiten Weltkrieges erneut in den Machtbereich der Nationalsozialisten, gleiches galt für die Familien, denen in der sogenannten „Polenaktion“ 1938 die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen worden war und die nach Polen abgeschoben wurden.
Die in Deutschland verbliebenen oder ins umliegende Ausland geflohenen Mädchen wurden spätestens seit Kriegsbeginn in Sammellagern oder sogenannten „Judenhäusern“ zusammengepfercht und in der Folge meist mit ihren Familien nach Polen, Tschechien oder ins Baltikum deportiert und ermordet. Keine jüdische Familie hat die Shoa ohne Verluste an Menschenleben überstanden.
Den Nationalsozialisten lag aus ideologischen Gründen die höhere Bildung von Mädchen wenig am Herzen. Stattdessen wurde Hauswirtschaft und Säuglingspflege in den Vordergrund gerückt. Nach der Schulreform 1938 wurde aus den Höheren Mädchenschulen sogenannte „Deutsche Oberschulen“, die jeweils hauswirtschaftlich orientiert waren und auf die Soziale Frauenschule vorbereiteten. Nur an der Schule Findelgasse war es noch möglich, über den neusprachlichen Ausbildungsweg die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Nach der zwangsweisen Schließung der konfessionell gebundenen Mädchenschulen herrschte drangvolle Enge und nachdem die wenigen neu eingestellten Junglehrer zum Kriegsdienst eingezogen worden waren und sich die Luftangriffe auf Nürnberg mehrten, konnte der Unterricht nur noch mit Einschränkungen durchgeführt werden. Die Unterklassen wurden schließlich zusammen mit einigen älteren Lehrkräften in die „Kinderlandverschickung“ in die Sudeten gebracht.
1945 wurde das Schulhaus Findelgasse 9 vollständig zerstört. Nach dem Krieg wurde der Unterricht erst im Januar1946 wieder provisorisch im Zeltnerschulhaus aufgenommen. 1958 entstand für die Schule ein neues Gebäude in Gibitzenhof. Die Schule erhielt bei dessen Einweihung den Namen Sigena-Oberrealschule für Mädchen. Seit 1974 besuchen auch Jungen das heutige Sigena-Gymnasium.
2007 wurde erstmals die Geschichte der jüdischen Schülerinnen der Schule während des Nationalsozialismus durch eine Arbeitsgruppe von Schülerinnen und Schülern erforscht und in einer Publikation zusammengefasst, welche auch zahlreiche Zeitzeugenberichte der damals noch lebenden Schülerinnen zusammentrug. Seitdem erinnert eine Gedenktafel in der Aula des Sigena-Gymnasiums an das Schicksal der ermordeten und vertriebenen Mädchen. 2024/25 entstand im Nachgang zum 200jährigen Schuljubiläum von Seiten der Schülerinnen und Schüler der Wunsch, auch an der Stelle der ehemaligen Schule in der Findelgasse durch eine Stolperschwelle an dieses dunkle und weitgehend vergessene Kapitel der Nürnberger Stadt- und Schulgeschichte zu erinnern.
Wolf-Martin Hergert