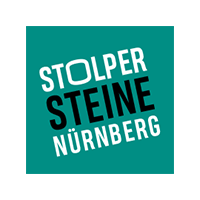Rede von Bernd Siegler zur Stolpersteinverlegung am 30. April 2023
Wer war Dr. Leopold Neuburger, dessen wir hier gedenken und wer war seine Frau Hedwig und ihre beiden Kinder Hilde und Kurt, an den ab heute in Nürnberg zwei Stolpersteine erinnern?
Nicht auf dem Spielfeld, sondern in vorderster Linie als Vereinsvorsitzender hatte der jüdische Rechtsanwalt Dr. Leopold Neuburger den Club in Zeiten geführt, wo es galt, ganz entscheidende Weichen zu stellen. Von 1912 bis 1914 und von 1919 bis 1921 stand der Rechtsanwalt an der Spitze des Vereins.
Neuburger kam am 14. Oktober 1881 in Nürnberg als Sohn des jüdischen Kaufmanns Salomon Neuburger und seiner Gattin Auguste, geb. Lerchenthal, zur Welt. Er studierte Jura, ließ sich in Nürnberg als Rechts-anwalt nieder und heiratete am 3. November 1913 Hedwig, geb. Berlin.
In seiner ersten Amtszeit als Vorsitzender des 1. FC Nürnberg initiierte er den Kauf und Ausbau der ersten großen vereinseigenen Sportanlage, den Sportpark Zabo. Ein eigenes Stadion als wichtigster Schritt für die weitere Entwicklung des Clubs.
Neuburger hatte als Standort für den Sportpark die Nürnberger Vorortgemeinde Zerzabelshof ausgewählt, da Vereine dort – anders als innerhalb der Stadtgrenzen Nürnbergs – keine »Lustbarkeitssteuer« auf Einnahmen aus Sportveranstaltungen abführen mussten. So erwarb man in Zerzabelshof Land, um darauf einen modernen Sportpark zu errichten.
Am 23. August 1913 war es soweit. Der Zabo wurde mit einem Gartenfest und einem Konzert der Öffentlichkeit präsentiert und am nächsten Tag mit einem Spiel gegen Eintracht Braunschweig (3:5) offiziell eingeweiht. Die stattliche Anlage galt »als schönster Sportpark in ganz Deutschland«.
Dann kam der 1. Weltkrieg. Nach seinem Einsatz an der Westfront wurde Neuburger im Oktober 1915 an die Ostfront geschickt. Dort wurde er verschüttet und kehrte erst nach monatelangem Lazarett-Aufenthalt nach Nürnberg zurück. Im März 1919 wurde er erneut zum 1. Vorsitzenden gewählt und legte die Grundlagen für den kometenhaften Aufstieg des 1. FC Nürnberg in den »Goldenen 20er Jahren«.
Nach dem Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft 1920 mit einem 2:0 gegen die Spielvereinigung Fürth war der Club ein Zuschauermagnet. Neuburger betrieb die Vergrößerung der Sportanlage Zabo. Die Zuschauerkapazität des Hauptplatzes wurde auf knapp 25.000 Plätze erweitert.
Zu dieser Zeit hatte sich Neuburger berufsbedingt schon von der Club-Spitze zurückgezogen. Sein Nachfolger Karl Müller lobte ihn »als glänzenden Anwalt, der als 1. Vorstand stets ein hervorragender Sprecher und Sachwalter der Club-Interessen war«. Neuburger blieb dem Club als Vorsitzender des Schlichtungsausschusses und Mitglied des Verwaltungsausschusses erhalten.
Am 25. Juli 1928 verstarb der Rechtsanwalt im Alter von nur 46 Jahren. In der Vereinszeitung vom August 1928 war zu lesen: »Dr. Neuburgers Verdienste um den 1. F. C. N. als treues Mitglied, bahnbrechender und zielsicherer Führer und begeisterter Mitarbeiter, sind so innig mit dem sieghaften Aufstieg unseres Vereins verknüpft, dass er sich durch sein Verdienst ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat.«
Als sein Vermächtnis hatte Neuburger in der Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum des Clubs ein klares Bekenntnis zur Völkerverständigung und gegen Nationalismus im Sport hinterlassen. Schon der erste Satz seines Beitrags mit dem Titel »Sport und Politik« hat es in sich: »Unser Club, sowie die Verbände, denen er angehört, stehen auf politisch und religiös neutraler Grundlage.« Es ging ihm darum, »den Grundsatz absoluter politischer Neutralität erneut festzulegen.«
Für Neuburger war Sport – wie auch für den jüdischen Kicker-Herausgeber Walther Bensemann - ein Mittel der Völkerverständigung: »Wollte man die Sportausübung in den Grenzen des Landes festhalten, wollte man in strenger Durchführung dieses Gedankens alle ausländischen Einflüsse auf das deutsche Sportleben unterbinden, der Sport müsste an dieser Inzucht zugrunde gehen.«
Er verwahrte sich gegen nationalistische Bestrebungen: »Je enger sich die internationalen Bande des Sports knüpfen, umso mehr werden bei den einzelnen Völkern das Verständnis und die Achtung für das Wesen des anderen geweckt und gefördert.« Der Sport schlägt »die Brücke der Verständigung von dem einen zum andern Volk«.
Der 1. FCN gedenkt an Dr. Leopold Neuburger. Einen Stolperstein kann er nicht bekommen, weil er vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten verstorben ist. Stolpersteine sollen, so der Künstler Gunter Demnig, der dieses Projekt im Jahr 1992 begonnen hat, an das Schicksal der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit), also ab 30. Januar 1933 verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.
Stolpersteine erhalten jedoch heute seine Witwe Hedwig und ihre beiden Kinder Hilde und Kurt
Hedwig Neuburger spielte Tennis beim Club. In der Mitgliedskartei wurde sie nur als »Frau Neuburger« geführt. Sie bezahlte regelmäßig quartalsweise ihre Mitgliedsbeiträge. Bei ihr verzichtete man in der Mitgliederkartei auf den Stempel »30. APR. 1933« – vielleicht aus Respekt, weil ihr Mann der ehemalige Vereinsvorsitzendes war.
Hedwig Neuburger wurde am 17. Mai 1892 in Nürnberg als Tochter des jüdischen Kaufmanns Ernst Berlin und seiner Frau Rosa (geb. Hanau) in Nürnberg geboren. Sie wuchs mit drei Brüdern auf: Friedrich-Wilhelm, Hans-Ludwig, der im Ersten Weltkrieg 1914 an der Ostfront fiel, und Robert, der bereits am 21. Mai 1909 im Alter von zehn Jahren starb.
Am 3. November 1913 heiratete Hedwig Berlin in Nürnberg den Rechtsanwalt Dr. Leopold Neuburger. Das Paar wohnte am Prinzregentenufer 3 und bekam zwei Kinder: Kurt (* 1. 11. 1914, Nürnberg) und Hilde (* 14. 11. 1919, Nürnberg).
Kurt besuchte das Königliche Alte Gymnasium Nürnberg, das heutige Melanchthon-Gymnasium. Er wurde am 1. Oktober 1924 ebenfalls Mitglied des 1. FC Nürnberg und zwar in der Leichtathletikabteilung. Beim Ausschluss der jüdischen Mitglieder zum 30. April 1933 wurde er offenbar übersehen. Die Club-Mitgliedsverwaltung holte diesen Schritt am 31. Dezember 1933 mit einem entsprechenden Stempel in der Rubrik »Austritt« nach.
Hedwig Neuburgers Vater war am 25. November 1921 gestorben. Am 25. Juli 1928 starb ihr Mann im Alter von nur 46 Jahren. Sohn Kurt war zu dem Zeitpunkt gerade 13, Tochter Hilde erst sieben Jahre an. Hedwig Neuburger, die nun alleinerziehende Mutter zweier Kinder, zog am 21. Januar 1933 hierher in die Lohengrinstraße 13. Das war ihr letzter freiwillig gewählter Wohnsitz. Sie wohnte hier drei Jahre und drei Monate.
Ab April 1936 musste die Rechtsanwaltswitwe zusammen mit ihrer Mutter Rosa noch viermal innerhalb des Stadtgebietes umziehen – zunächst in die Lohengrinstraße 17, dann in die Blumenstraße 15, die Grimmstraße 37 und zuletzt am 10. März 1941 in die Virchowstraße 22.
Drei Monate später, am 8. Juni 1941, starb Mutter Rosa. Knapp ein halbes Jahr später wurde Hedwig Neuburger deportiert. »Von Amts wegen abgemeldet am 27. 11. 41 nach Riga«. So steht es auf der Meldekarte – eine bürokratische Umschreibung für die Deportation in ein Konzentrationslager. Hedwig Neuburger war unter den 1.008 Juden aus Nürnberg, die am 29. November 1941 nach Jungfernhof nahe Riga deportiert wurden und dort drei Tage später ankamen. Hedwig Neuburger wurde im KZ Riga-Jungfernhof ermordet, das genaue Datum ist nicht bekannt, offiziell gilt sie als verschollen.
Ihre beiden Kinder überlebten die Schoah. Sohn Kurt war am 28. April 1933 von Hamburg nach London gefahren. Am 18. September 1934 kehrte er noch einmal zu seiner Mutter nach Nürnberg zurück, um fünf Wochen später, am 24. Oktober 1934 endgültig nach Großbritannien zu emigrieren. Kurt Neuburger studierte Jura und wohnte im Londoner Stadtteil Bayswater. Wie alle deutschen jüdischen Flüchtlinge in England galt er nach Beginn des Zweiten Weltkrieges als »Male Enemy Alien« also als feindlicher Ausländer. Im Juni 1940 wurde er interniert und am 1. November 1940 wieder entlassen. Dann verliert sich seine Spur.
Seine Schwester Hilde war bei der Meldebehörde am 13. Januar 1937 nach Lausanne abgemeldet worden. Von dort emigrierte sie ebenfalls nach England und arbeitete als Hausmädchen. 1939 war sie in Twickenham, Middlesex, gemeldet. Dann verliert sich auch ihre Spur.